Schulen
Hier finden Sie Informationen zu den Schulen in Werther.
Im Einzelnen:
45 Treffer
-
 Ansichtskarte von Häger mit Fotos der Schule und der Mühle (1915)
Ansichtskarte von Häger mit Fotos der Schule und der Mühle (1915) -
 Bericht über einen Schulgottesdienst der dritten und vierten Klassen
Bericht über einen Schulgottesdienst der dritten und vierten Klassen -
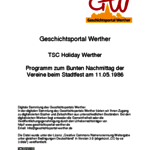 Bunter Nachmittag der Vereine beim Stadtfest 1986
Bunter Nachmittag der Vereine beim Stadtfest 1986 -
 Feuerwehrübung, Volksschule Werther
Feuerwehrübung, Volksschule Werther -
 Frühschicht - Andachten im EGW
Frühschicht - Andachten im EGW -
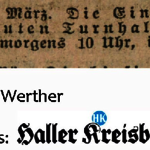 Haller Kreisblatt, 1930 03 01, Einweihung der neuerbauten Turnhalle
Haller Kreisblatt, 1930 03 01, Einweihung der neuerbauten Turnhalle -
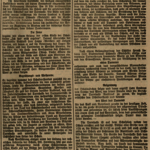 Haller Kreisblatt, 1930 03 04, Einweihung der neuen Turnhalle in Werther
Haller Kreisblatt, 1930 03 04, Einweihung der neuen Turnhalle in Werther -
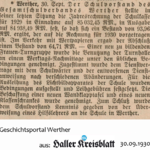 Haller Kreisblatt, 1930 09 30, Sitzung des Gesamtschulverbandes Werther
Haller Kreisblatt, 1930 09 30, Sitzung des Gesamtschulverbandes Werther -
 Jung trifft alt - Schüler der PAB-Gesamtschule helfen im Altenheim
Jung trifft alt - Schüler der PAB-Gesamtschule helfen im Altenheim -
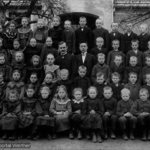 Klassenfoto Volksschule Langenheide 1905
Klassenfoto Volksschule Langenheide 1905 -
 Klassenfoto Volksschule Langenheide 1918
Klassenfoto Volksschule Langenheide 1918 -
 Klassenfoto Volksschule Langenheide 1928 1
Klassenfoto Volksschule Langenheide 1928 1 -
 Klassenfoto Volksschule Langenheide 1928 2
Klassenfoto Volksschule Langenheide 1928 2 -
 Klassenfoto Volksschule Langenheide 1929 1
Klassenfoto Volksschule Langenheide 1929 1 -
 Klassenfoto Volksschule Langenheide 1929 2
Klassenfoto Volksschule Langenheide 1929 2
